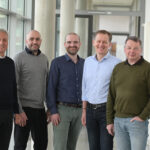Bildnachweis: olegganko_AdobeStock.
Kürzlich in den Medien sehr präsent waren die Auftritte von Martin Winterkorn vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig. Dort ist Winterkorn als Zeuge im Prozess zu den Abgasmanipulationen bei seinem ehemaligen Unternehmen Volkswagen geladen. „Aus heutiger Sicht hätte ich vertieft nachfragen sollen. Das habe ich nicht getan“, sagte der 76-Jährige. Er habe keine Kenntnis der „Abgasthematik“ gehabt. Das kann man glauben oder auch nicht. Das wird das Gericht zu bewerten haben. Hintergrund seiner Aussagen ist aber nicht seine persönliche Strafbarkeit, denn diese wird bereits in zwei anderen Prozessen untersucht.
In Braunschweig geht es dagegen um die zivilrechtliche Schadensersatzpflicht des Volkswagen-Konzerns nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG). Seit 2018 wird über möglichen Schadenersatz für Investoren verhandelt, die nach dem Auffliegen des Skandals Kursverluste erlitten hatten. Derzeit geht es um rund 4,4 Mrd. EUR. Also kein Kleingeld. Winterkorn ist nach Herbert Diess und Matthias Müller der dritte frühere VW-Chef, der zur Sache vernommen wird.
Man geht also in dem VW-Musterverfahren bereits ins sechste Jahr. In den USA waren die amerikanischen Geschädigten wesentlich schneller abgefunden. Der deutsche Automobilhersteller bekannte sich im März 2017 der Verschwörung und der Behinderung der Justiz für schuldig und erklärte sich bereit, 4,3 Mrd. USD an straf- und zivilrechtlichen Strafen zu zahlen. Volkswagen hat außerdem drei Vergleiche mit US-Autobesitzern, Aufsichtsbehörden und Händlern geschlossen, die sich auf insgesamt mehr als 17 Mrd. USD belaufen, um Ansprüche im Zusammenhang mit dem Abgasbetrugsskandal beizulegen. Dazu gehören auch Vergleiche mit geschädigten Anlegern in den USA. Diese Fälle wurden bereits 2018 abgeschlossen. In dem Jahr begann also erst das deutsche Musterverfahren, in dem Deka Investments als Musterkläger vom OLG bestimmt wurde.
Leider erleben Anleger in Deutschland fast durchweg kafkaeske Prozessverfahren mit unglaublich langen Verfahrensdauern und Verschleppungstaktiken der beklagten Unternehmen.
Verfassungswidrig lange Prozessdauer
Das VW-Verfahren zeigt bereits, dass die Mühlen der Justiz in Deutschland unfassbar langsam mahlen. Besonders KapMuG-Prozesse dauern im Schnitt über zehn Jahre. Die Mutter aller Musterverfahren war der Prozess gegen die Telekom AG, der knapp 20 Jahre währte und im Laufe dessen etwa ein Viertel der ursprünglichen Kläger verstarben. Leider erleben Anleger in Deutschland fast durchweg kafkaeske Prozessverfahren mit unglaublich langen Verfahrensdauern und Verschleppungstaktiken der beklagten Unternehmen, siehe Telekom und Wirecard. Dem Gesetzgeber ist die Problematik bekannt. Die neue Regierung hat sich sogar im Koalitionsvertrag eine weitgehende Reform beim kollektiven Rechtsschutz als Aufgabe gegeben. So steht dort: „Wir bauen den kollektiven Rechtsschutz aus. Bestehende Instrumente wiez. B. nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz modernisieren wir und prüfen den Bedarf für weitere.“ Eine Modernisierung sollte jedenfalls eine erhebliche Beschleunigung der Verfahren bringen. Beispiel sollten die Class Actions des US-Rechts sein, die regelmäßig in einem zeitlich akzeptablen Rahmen zu Ergebnissen führen. Schließlich hat auch das Bundesverfassungsgericht die langen Prozesse moniert, und sieht darin einen „Verstoß gegen die Rechtsschutzgarantie“ des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz.
Nach langer Zeit der Untätigkeit hat die Koalition unlängst einen Reformvorschlag vorgelegt. Der vorgelegte Entwurf erreicht nach Ansicht vieler Experten jedoch nicht das Kernziel, nämlich die signifikante Verringerung der Verfahrensdauern. Bei Massenklagen liegen die Fälle alle sehr ähnlich und könnten eigentlich durch Typisierung beschleunigt bewältigt werden. Das Musterverfahren nach dem KapMuG soll anhand eines ausgewählten Musterklägers die wichtigen Sachfragen klären und am Ende ein Feststellungsurteil fällen. Bisher mussten alle Einzelklagen gegen das beklagte Unternehmen in diesem Zusammenhang ausgesetzt werden. Damit wurde eine Flucht ins KapMuG ausgelöst, denn dieses ist sehr langwierig und bietet die Möglichkeit, sich auf ein einziges Verfahren zu konzentrieren. Gleichfalls bietet es viele Optionen für Verschleppung und Verzögerung, zumal der Gerichtsweg umständlich ausgelegt ist. Die bislang vorgesehene zwingende Aussetzung aller anhängigen Klageverfahren ist im neuen Gesetzesentwurf nicht mehr enthalten. Jedoch enthält der Entwurf stattdessen eine „Opt-in-Regelung“, die es beiden Parteien jederzeit erlaubt, aus dem streitigen Klageverfahren in das Musterverfahren auszuweichen. Es ist davon auszugehen, dass diese Fluchtmöglichkeit vorzugsweise von der Beklagtenseite genutzt werden wird, um das Verfahren „auf die lange Bank“ zu schieben. Hier ist also keine Verbesserung zu erkennen. Kleine Fristverkürzungen im Gesetzesvorschlag führen ebenfalls nicht zu einer wirklichen Lösung der Probleme.
Lösungen liegen eigentlich auf dem Tisch
Was man besser machen könnte, kann man in Sachverständigengutachten nachlesen, die für eine Expertenanhörung im Herbst 2020 beim Rechtsausschuss des Bundestages hinterlegt wurden. Einige der Sachverständigen monierten die ständigen „Insellösungen“ des Gesetzgebers beim kollektiven Rechtsschutz. Hochschullehrer, wie etwa Prof. Dr. Axel Halfmeier von der Uni Lüneburg, bevorzugen eine Gesamtlösung, in der kollektiver Rechtsschutz für alle Geschädigten zur Verfügung steht, nicht getrennt nach Verbrauchern, Anlegern oder juristischen Personen. Diesen Ansatz wählte die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon 2015 mit ihrem, bis heute aktuellen, Entwurf einer Gruppenklage.
Dieser wurde allerdings vom Bundestag abgelehnt. Er sei zu sehr an das amerikanische System angelehnt und würde eine „Klageindustrie“ begünstigen. Der deutsche Gesetzgeber bevorzugte bei den Verbraucheransprüchen lieber eine Verbandsklage, was auch der Weg der EU-Richtlinie wurde. Diese begrenzt die Klagebefugnis bei Massenklagen auf einen sehr kleinen Kreis zugelassener Verbraucherverbände. Damit werden die Sammelklagen extrem minimiert und quasi unter staatliche Aufsicht gestellt, denn die meisten Verbraucherzentralen sind öffentlich finanziert. Das gilt sowohl für die verfehlte Musterfeststellungklage als auch die neue sog. Abhilfeklage. Bei dieser erwartet der Gesetzgeber ohnehin nur etwa 15 solcher Verfahren pro Jahr.
Nur beim KapMuG können Anleger direkt klagen, doch kommt beim KapMuG das Problem hinzu, dass die Kläger selbst bei Erfolg der Klage erstmal keinen Schadensersatz bekommen. Dazu Prof. Dr. Halfmeier: „Dieses Problem ist innerhalb des KapMuG kaum lösbar, da das Gesetz von vorneherein nicht auf einen gebündelten Abschluss der Verfahren abzielte, sondern nur auf die Einführung eines Zwischenverfahrens mit Feststellungswirkung.“
Fazit
Eine echte Reform würde also das zweigleisige System abschaffen und ein Leistungsurteil auf Schadensersatz zur Verfügung stellen. Außerdem fehlt bisher eine „Opt-out-Möglichkeit“. Dies würde den mutigeren Anlegern ermöglichen, bei sich endlos hinziehenden Verfahren auszusteigen und auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko selbst zu klagen. Realität ist aber leider: Die deutsche Justiz arbeitet im Schneckentempo, insbesondere im Bereich von Finanzstraftaten (siehe CumEx) und bei Anlegerklagen.
Autor/Autorin

Robert Peres
Robert Peres ist Rechtsanwalt mit Sitz inBerlin und Wiesbaden sowie Vorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre, die sich für die Stärkung der Aktionärsrechte in Deutschland einsetzt.