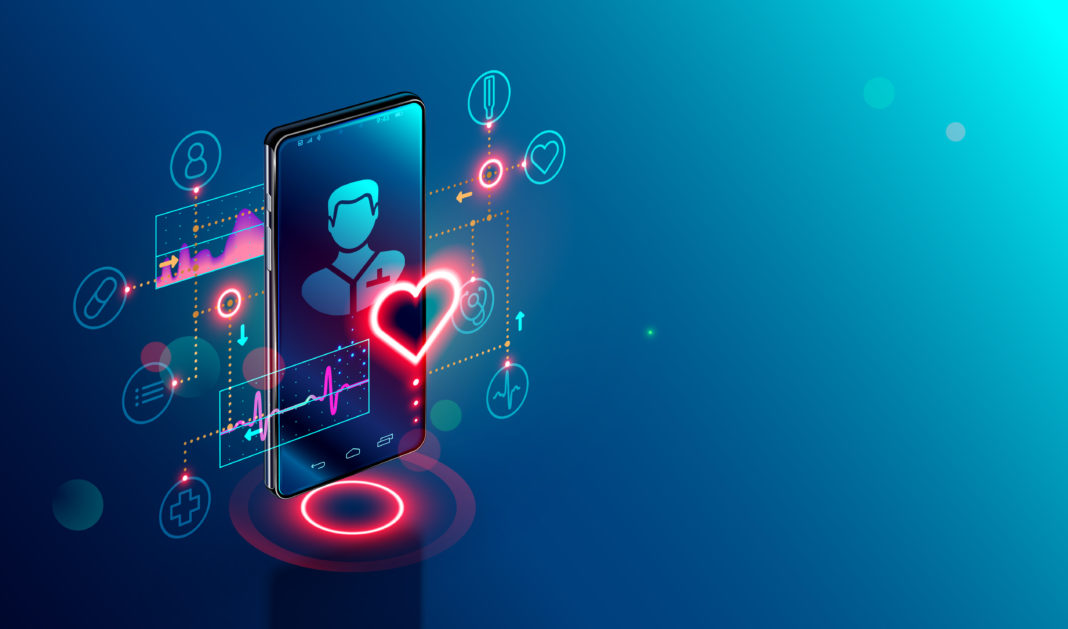Bildnachweis: AndSus – stock.adobe.com, Pinsent Masons.
Der Gesetzgeber nimmt für sich in Anspruch, den digitalen Fortschritt im Gesundheitswesen mit dem im Dezember 2019 in Kraft getretenen Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) einen großen Schritt vorangetrieben zu haben. Gesetzlich Versicherte haben seither einen Anspruch auf die Versorgung mit sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Diese Wende macht auch die Entwicklung entsprechender Anwendungen erheblich attraktiver. Bevor eine DiGA in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden kann, muss der Hersteller die Aufnahme in das sogenannte DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beantragen. Von Marc L. Holtorf und Theresa Merz
Seit Öffnung des Antragsverfahrens Ende Mai 2020 wurden beim BfArM insgesamt 69 Anträge zur (vorläufigen) Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis gestellt; davon wurden 27 während der Prüfung durch das BfArM wieder zurückgezogen. Aktuell sind 15 digitale Gesundheitsanwendungen im Verzeichnis gelistet – und nur fünf davon dauerhaft.
Die sehr geringe Zahl der im DiGA-Verzeichnis gelisteten digitalen Gesundheitsanwendungen lässt sich kaum als Erfolg darstellen. Es besteht Anpassungsbedarf für den Gesetzgeber, wie ein Blick auf das Verfahren zeigt.
Von der App zur DiGA – was muss der digitale Helfer leisten können?
Als DiGA kann nur ein Medizinprodukt niedriger Risikoklasse zugelassen werden, dessen Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien beruht und das dazu bestimmt ist, die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen zu unterstützen.

Auf den ersten Blick ist nicht unbedingt klar, was der Gesetzgeber erwartet, wenn er verlangt, dass die Hauptfunktion der DiGA auf einer digitalen Technologie beruhen solle. Die digitale Technologie ist dann nicht mehr die Hauptfunktion der App, wenn sie lediglich der Ergänzung oder Steuerung anderer Medizinprodukte dient. Das ist z.B. der Fall sein, wenn die App nur dazu dient, ein separates Gerät auszulesen, also beispielsweise anzeigt, wie viele Atemaussetzer ein Brustgurt nachts beim Patienten gemessen hat. Anders würde die Bewertung hingegen ausfallen, wenn die App nicht nur die Zahl der vom Brustgurt gemessenen Atemaussetzer ausliest, sondern diese zusätzlich mit der Pulsfrequenz einer als Medizinprodukt zugelassenen Smartwatch digital kombiniert und dadurch eine genauere Diagnostik ermöglicht.
Die geforderte Bestimmung zur Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen schließt die Zulassung sogenannter Lifestyle-Apps als DiGA aus. Hierunter fallen Apps, die „nur“ darauf abzielen, den allgemeinen Lebensstil von gesunden Menschen, z.B. durch Tipps zu Sport und Ernährung, zu verbessern.
Voraussetzungen der Erstattungsfähigkeit einer medizinischen App
Die Übernahme der Kosten für eine DiGA durch die gesetzlichen Krankenversicherungen setzt deren Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis und eine entsprechende ärztliche Verordnung oder Genehmigung der Krankenkasse voraus.
Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis – welche Anträge sind möglich?
Die Aufnahme der DiGA in das DiGA-Verzeichnis ist vom Hersteller der App online über ein elektronisches Portal des BfArM, abrufbar unter diga.bfarm.de/antrag/de, zu beantragen. Das BfArM stellt auf seiner Internetseite eine Ausfüllhilfe sowie einen Leitfaden zur Verfügung, mittels derer eine Vielzahl von potenziellen Fragen der Hersteller zum Antragsverfahren beantwortet werden.

Der Hersteller kann entscheiden, ob er zunächst nur eine vorläufige oder gleich eine endgültige Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis beantragen möchte. Für die Entscheidung ist maßgeblich, ob dem Hersteller bereits eine vergleichende Studie zum Nachweis eines sogenannten positiven Versorgungseffekts vorliegt. Die Studie muss zeigen, dass die Anwendung der DiGA „besser“ ist als deren Nichtanwendung. Das ist dann der Fall, wenn sie bei einer bestimmten Patientengruppe entweder einen medizinischen Nutzen oder eine patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserung in der Versorgung bewirkt (= positiver Versorgungseffekt).
Mit dem Antrag auf eine nur vorläufige Aufnahme wird dem Hersteller eine weitere Erprobung des Versorgungseffekts von bis zu zwölf Monaten ermöglicht. Nach Ablauf des Erprobungszeitraums prüft das BfArM, ob der Hersteller mittlerweile einen positiven Versorgungseffekt nachweisen kann. Ist dies der Fall, kann die DiGA endgültig in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen werden.
Die Erprobungsphase kann im Einzelfall einmalig um bis zu zwölf Monate verlängert werden, wenn wahrscheinlich ist, dass der Hersteller den positiven Versorgungseffekt zu einem späteren Zeitpunkt nachweisen kann. Die Verlängerung muss spätestens drei Monate vor Ablauf der Erprobungsphase beantragt und begründet werden.
Beantragt der Hersteller die endgültige Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis, entscheidet das BfArM innerhalb von drei Monaten über die Zulassung. Wird der Antrag auf endgültige Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis vom BfArM wegen fehlender positiver Versorgungseffekte abgelehnt, kann ein neuer Antrag erst nach Ablauf von zwölf Monaten gestellt werden.
Prüfungsumfang des BfArM
Zusätzlich zum Nachweis eines positiven Versorgungseffekts muss der Antrag außerdem Nachweise über die Sicherheit, Funktionstauglichkeit und Qualität der DiGA sowie über die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit enthalten.
Der Nachweis über die Sicherheit und Funktionstauglichkeit der DiGA gilt grundsätzlich bereits durch die CE-Kennzeichnung als erbracht. Das BfArM ist jedoch berechtigt, auch weitere Prüfungen durchzuführen und entsprechende Nachweise zu verlangen.
Die Qualität der DiGA wird anhand von Kriterien wie der Interoperabilität, des Verbraucherschutzes sowie der Nutzerfreundlichkeit bewertet. Interoperabilität meint die Eigenschaft technischer Systeme, auf technisch-syntaktischer, semantischer und organisatorischer Ebene zusammenarbeiten zu können. Einen Mehrwert in der Versorgung kann eine DiGA nur erzielen, wenn sie mit anderen Anwendungen zu kommunizieren vermag und die übertragenen Informationen der DiGA auch vom Empfänger ausgelesen werden können. Soll die DiGA wie im oben genannten Beispiel bei der Diagnostik von nächtlichen Atemaussetzern gepaart mit einer auffälligen Pulsfrequenz unterstützen, muss gewährleistet sein, dass sie interoperable Schnittstellen verwendet und so mit den jeweils vom Patienten genutzten privaten Geräten kommunizieren kann.
Mit Blick auf den Verbraucherschutz muss die DiGA dem Versicherten vor Beginn der Nutzung Informationen zu Funktionsumfang und Zweckbestimmung sowie zu den vertraglichen Bedingungen der Nutzung zur Verfügung stellen. Die DiGA darf außerdem keine Werbung oder intransparente Angebote, wie sich automatisch verlängernde Abonnements, enthalten. Außerdem soll sie leicht und intuitiv zu bedienen sein, was durch das Angebot eines kostenlosen deutschsprachigen Supports sichergestellt werden soll.
Um die Einhaltung wesentlicher Datenschutzaspekte nachzuweisen, muss der Hersteller bei der Antragstellung eine entsprechende Selbsterklärung abgeben. Grundvoraussetzung für die Zulassung der DiGA ist, dass personenbezogene Daten nur zu bestimmten Zwecken, wie z.B. dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der DiGA oder dem Nachweis positiver Versorgungseffekte, und auch nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Versicherten verarbeitet werden.
Das Rezept für die App
Schließlich haben gesetzlich Versicherte nur dann einen Anspruch auf Erstattung des DiGA-Einsatzes, wenn sie eine ärztliche Verordnung oder eine Genehmigung der gesetzlichen Krankenkasse erhalten haben. Mit der letztgenannten Option soll die Eigenständigkeit des Versicherten gestärkt werden. Hiergegen bestehen insofern keine Bedenken, als die DiGA ohnehin ein geringes Risikopotenzial aufweist und die positiven Versorgungseffekte mit der Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis nachgewiesen sind.
Fazit
Die Zahl der seit Öffnung des Antragsverfahrens in das DiGA-Verzeichnis aufgenommenen DiGA ist sehr überschaubar. Augenscheinlich besteht im Hinblick auf die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren Anpassungsbedarf. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen scheinen mit der digitalen Transformation noch nicht Schritt zu halten. Zu den Optimierungsmöglichkeiten gehört z.B. die vom Sachverständigenrat Gesundheit vorgeschlagene Erweiterung des gesetzlichen Anwendungsbereichs auf Medizinprodukte der Klassen IIb und III. Ebenso muss dafür gesorgt werden, dass das Aufnahmeverfahren und weitere Aspekte der Erstattung von DiGA beschleunigt werden. Die Verhandlungen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen mit den DiGA-Herstellern zu deren Vergütung sind noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Streitpunkt ist die Einführung von Höchstpreisen und Schwellenwerten in den zu schließenden Rahmenvertrag. Die Krankenkassen möchten vermeiden, dass die Hersteller den Preis ihrer DiGA im ersten Jahr nach der Zulassung völlig frei bestimmen können – so sieht es das Gesetz aber vor. Eine Einigung ist derzeit nicht absehbar.
Der Weg der DiGA zum standardisierten Mittel der Wahl im deutschen Gesundheitsversorgungssystem hat gerade erst begonnen.
ZU DEN AUTOREN
Marc L. Holtorf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Partner, Head of German IP and Life Sciences, Pinsent Masons Germany LLP, München.
Theresa Merz, LL.M. (Eur.), Rechtsanwältin, Teil des internationalen Teams für gewerblichen Rechtsschutz mit Fokus auf dem Life-Sciences-Sektor, Pinsent Masons Germany LLP, München.
Autor/Autorin
Die Redaktion der Kapitalmarkt Plattform GoingPublic (Magazin, www.goingpublic.de, LinkedIn Kanal, Events) widmet sich seit Dezember 1997 den aktuellen Trends rund um die Finanzierung über die Börse. Ob Börsengang (GoingPublic) oder die vielfältigen Herausforderungen für börsennotierte Unternehmen (Being Public), präsentiert sich GoingPublic cross-medial als Kapitalmarktplattform für Emittenten und Investment Professionals.